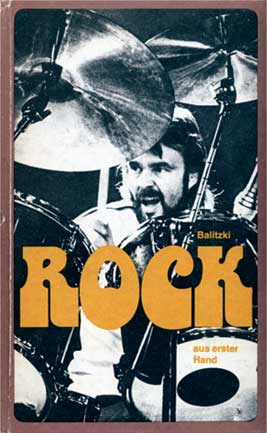Engerling
Wolfram „Boddi” Bodag – voc, keyb, harm
Heinrich Witte – g
Henry Butschke – dr (seit April 1984)
Christian Liebig – b (seit September 1984)
Andreas Kaufmann – sax (seit September 1984)
Gegründet 1975
Diskographie
Singles:
Da hilft kein Jammern/ Die weiße Ziege (1977)
Mama Wilson/ Schwester Bessies Boogie (1978)
Knüppel aus dem Sack/ Nachtliedchen (1980)
Narkose-Blues/ Frühprogramm (1985)
LP:
Engerling (1978)
Tagtraum (1981)
Gespräch mit Boddi am 24.10.1983
Zuerst bitte ich dich, die Entwicklung von Engerling zu umreißen.
Aus der ehemaligen Gruppe Pardon ging 1975 Engerling mit folgenden Musikern hervor: Rainer Lojewski (Schlagzeug), Erhard Klauschenz (Bass) und Wolfram Bodag (Klavier, Gesang). Der Rest stand noch nicht fest. Ein Jahr lang war erst mal Probe – mit Geige, ohne Geige. Der erste Auftritt fand mit einer teilweise geborgten Anlage im Studentenklub der Humboldt-Uni statt. Wir spielten ausschließlich Blues.
Warum?
Es hatte was Nostalgisches. Aus den 60ern kannten wir eben berühmte Lieder von den Stones, Animals, Van Morrison, Pretty Things... Damals verbanden wir diese Bands gar nicht mit dem Begriff Blues. Im Prinzip handelte es sich um ein Nachholen praktischer Art von Jugenderfahrungen. Zweitens stand uns keine große Anlage zur Verfügung, also schieden Stücke von Deep Purple und anderen Bands der beginnenden siebziger Jahre aus. Blues bzw. Rhythm and Blues war eben machbar.
Hattest du eine musikalische Ausbildung?
Ein Jahr Klavierunterricht mit neun Jahren. Radsport gefiel mir besser, deshalb schmiss ich den Unterricht.
Hättest du eine Karriere als Radsportler haben können?
Weiß ich nicht. Mit 15 Jahren ging es noch ganz gut. Aber dann kam der Wettkampf Stones – Beatles, der meine Freizeit bestimmte. Ich hatte mich natürlich für die härtere Variante entschieden!
Warum? Entsprachen die Stones mehr deinem Wesen?
Die Beatles-Fans gefielen mir nicht so gut, sie waren mir zu lackig. Die Stones-Verehrer kamen mir interessanter vor. Ich war damals unheimlich neugierig auf das Verhalten von Leuten. Ich wuchs in Falkenberg auf, einem kleinen Dörfchen im Oderbruch. Dort gab es ein Heim für Diplomaten-Kinder, und die besaßen viele Platten. Dadurch schloss ich nähere Bekanntschaft mit der frühen Rockmusik. Wie viele Jungen von damals lernte ich Gitarre. Erst in der zehnten, elften Klasse kehrte ich zum Klavier zurück. Dabei dachte ich weniger an Rockmusik. Richtig los ging es erst bei der Armee. Wir hatten ziemlich viel Zeit, und es fand sich jemand, der es mir beibrachte. Das war 1968. Der Bassist der dort gegründeten Band nahm mich nach unserer Entlassung mit nach Berlin, wo ich auch studieren wollte. Mobil hieß die Truppe. Das war 1970. Damals spielten wir Titel von Jimi Hendrix und härtere Sachen. Blues kam erst zwei Jahre später bei Pardon und dann natürlich, ab 1975, bei Engerling. Das war der kleinste Verständigungsnenner.
Wie verlief euer erstes Konzert im Studentenklub?
Das war grandios, die Leute haben getobt. Der Geiger spielte wie Sugarcane Harris. Das war natürlich was. In dieser Zeit verabschiedete ich mich von meinem gerade begonnenen Kulturwissenschafts-Studium. Es entsprach leider nicht meinem Wesen. Die Perspektive gefiel mir nicht. Musik hatte mich schon gepackt. Irgendwie war es nicht anders möglich. Ich bin dann sofort zur Musikschule Friedrichshain gegangen und fing in der Uni als Haushandwerker an.
Und Engerling begann seinen Siegeszug!
Ja, schon. Wir tingelten anderthalb Jahre rum, zu Anfang mit riesigem Erfolg. Man hat es nicht geglaubt. Es war mir auch schon richtig peinlich, denn wir beherrschten gar nicht so viele Titel, und so gab es Abende, wo wir dreimal hintereinander unser Repertoire kommen ließen. Wir reisten ziemlich viel herum, sogar nach Thüringen. Wir wussten, dass die Thüringer in Sachen Blues und Improvisation den Berlinern voraus waren.
Wir spielten damals Titel von Elmor James, Van Morrison, den Allman-Brothers – ermöglicht durch den zweiten Gitarristen – und ein paar knackige Stones-Nummern, die man einfach nicht lassen konnte.
Wann kam der Durchbruch zu eigenen Stücken?
Inzwischen existierten viele Bluesbands, und überall hörte man dieselben Titel. Irgendwie kamen wir uns vor wie Mitschwimmer auf einer Welle, obgleich wir ja in der DDR zu den ersten Bluesspielern gehörten. Durch einige Berliner Leistungsvergleiche angespornt, gaben wir uns einen Ruck, Neues anzubieten. Die eigenen Sachen kamen ziemlich locker von der Hand, das Bluesgefühl hatte man drin, und die Textform hatte ich auch drauf. Um Inhalte hatte ich mich schon in den sechziger Jahren gekümmert, sang zum Beispiel deutsche Übersetzungen von amerikanischen Bluesstücken in der Falkenberger Band Blues-Fashion. Ja, und 1976 beteiligten wir uns an einem Berliner Ausscheid für die Suhler FDJ-Werkstattwoche Jugendtanzmusik. Die Jury warf uns damals vor, wir seien im Blues der vierziger Jahre stecken geblieben. Wir waren geknickt. Da nun aber die angeblich bessere Band doch nicht nach Suhl fahren konnte – jemand war erkrankt –, traf es uns. Wir schlugen ein wie eine Bombe. Ein Teil der Band war daraufhin sehr euphorisch, ich sehr vorsichtig. In einer Texterwerkstatt äußerte sich Kurt Demmler positiv zu meinen Sachen, zum Beispiel zu „Die weiße Ziege”, „Da hilft kein Jammern” und „Die dünne Haut”. Als wir dann nach Berlin zurückkehrten, meldete sich Amiga und wollte Probeaufnahmen anfertigen. ich war immer noch sehr vorsichtig. Wir spielten dort zehn Titel ein, die Reaktion war abwartend. Plötzlich, wir rechneten nicht damit, kam ein Brief: Wir haben beschlossen, eine Single aufzunehmen mit „Die weiße Ziege” und „Da hilft kein Jammern”. Ich bin bald umgefallen! Gegen die „Weiße Ziege” gab es ja nichts zu sagen, aber „Da hilft kein Jammern”! Die Musik stammte eigentlich von Willie Dixon oder den Doors. Wir hatten einen deutschen Text dazu gemacht. Wir haben auch Blues ständig so erlebt, dass wir zum Beispiel die Clapton-Fassung schon von Elmor James oder Robert Johnson kannten. Und Muddy Waters stand uns bei, als er mal sagte: Machste zu einem alten Blues einen neuen Text, singste ein bisschen anders – schon ist ein neuer Blues da. Eigentlich geht es auch gar nicht anders. Es existieren vielleicht zehn Grundvarianten. Und mit den drei Harmonien kann man nicht viel anfangen. Die anderen Titel fanden leider keine Zustimmung. Es blieben nur die beiden übrig. Der damalige Kapellenleiter gab mich als Autor an, deutete zwar an, dass es die Musik schon gäbe, aber da der Text von mir stammte, stand offenbar der Single nichts mehr im Wege. Als die Single erschien, wussten alle Bluesfans, was los war. Die rannten mir die Bude ein. Das war mir sehr peinlich. Es gab aber nur eins: neue Nummern machen, die Scharte auswetzen.
Wie sahen die Konsequenzen aus, gab es Reaktionen?
Zunächst nicht. Irgendwann rief ein Diskotheker anonym an, und ich musste eine Stellungnahme schreiben. Das passierte aber erst 1982! Ein Schreiben von der Kriminalpolizei traf ein, und ich musste Strafe zahlen. Glücklicherweise hatte ich bei der AWA nur den Text angemeldet. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Ein Jahr spielst du noch und dann ist Schluss. Mein Gewissen war immerhin etwas beruhigt.
Die Single, 1977 erschienen, war aber ein Erfolg!
Na klar, die war sofort weg. Deshalb produzierten wir 1977 die zweite Single „Mama Wilson” und „Schwester Bessies Boogie”. Und 1978 war die erste LP angesagt.
Wie reagierte euer Publikum auf die ersten Plattenveröffentlichungen?
Es war ganz merkwürdig. Die richtigen eingefleischten Bluesfans fühlten sich betrogen. Eine Engerling-Schallplatte passte nicht in ihr Blues-Bild. „Die kannste jetzt vajessen”, meinten sie. Plötzlich blieben sie weg, die uns immer hinterher gereist waren. Glücklicherweise kamen dafür andere! Ich glaube, durch diese Reaktionen haben wir uns als Band ein bisschen überworfen. Die LP erschien 1978. Ich selbst war nie richtig bereit, die eigenen Nummern zu spielen. Die anderen Titel waren mir zu lieb. Mir fehlte wahrscheinlich Selbstvertrauen. „Mama Wilson”, zwei, drei andere und den „Moll-Blues” habe ich sehr gern gespielt, mehr nicht. Irgendwann kamen aber massive Reaktionen aus dem Publikum, das das Eigene von uns forderte. Wir haben es dann gemacht, aber immer noch halbherzig. Komisch! Die Angebote für Konzerte nahmen zu. Wir waren aber immer noch Amateure, die meisten gingen noch arbeiten. Ich wurde dann in die Spezialklasse Friedrichshain aufgenommen zur Erlangung des Berufsausweises. Die anderen wollten es auch, ließen sich eintragen, gingen aber leider nie hin. Die Vorwürfe musste natürlich ich einstecken!
Hattest du nicht die Autorität, deine Kollegen von der Notwendigkeit des Schulbesuches zu überzeugen?
Ich würde eine solche Autorität nicht haben wollen! Die eigene Entscheidung wäre mir lieber gewesen. Es gab dann Umbesetzungen. Außerdem ging mir der Blues zu der Zeit ziemlich auf den Keks. Es war so: Kaum hattest du die Mundharmonika in der Hand, stand der Saal Kopf. Sofort hörtest du zehn Mundharmonikas von unten zurück. Ich konnte es nicht mehr hören, zog mich zurück, holte mir einen Saxophonisten. Und sofort kam was Neues ins Spiel. Es wurde jazziger. Die 80er Besetzung will ich mal nennen: Peter Lucht (Schlagzeug), Tilo Ferch (Saxophon), Heiner Witte (Gitarre), als einziger von der alten Band, und Gunther Krex (Bass). Zwei Monate Probe, und los ging es. Wenige, aber wichtige Leute stimmten uns zu, die Masse war über das neue Konzept völlig frustriert! Man kann sowas ja ein halbes Jahr ertragen, dann geht es eben nicht mehr. Wir wollten aber auch nicht mehr zu den alten Blues-Nummern zurück. Da blieb nur eins: hinsetzen, eigene, neue Sachen schreiben. Die führten dann zur zweiten LP. Das Selbstverständnis sah nun ganz anders aus! In dieser neuen Besetzung, mit den neuen Titeln fühlte ich mich wohler. Die habe ich richtig gern gespielt.
Warum?
Weil auch die Zeit anders war. Ich wurde Vater... Früher sah mein Image anders aus, ein bisschen Frauenfeind – „Da hilft kein Jammern!” – ein verkniffenes Gesicht... Na, und dann verfügten wir auch über eine bessere Technik. Es kam vieles zusammen.
Bleiben wir mal bei den Frauen. „Die weiße Ziege” war doch eine Art Vergangenheitsbewältigung?
Das war sie. Noch mit 25 Jahren bestand ich auf meiner Zeit mit dem Fahrrad. Das war ein schneeweißes Rad, eben die weiße Ziege. Mein Mädel entschied sich seinerzeit für den Lokomotivführer, von dem im Text die Rede ist. So ergab sich auch die Verbindung zum traditionellen Blues, in dem Züge ja eine sehr große Rolle spielen, Abfahrt, Abbruch, Aufbruch zu Neuem.
Für mich stellt dieser Text eine Besonderheit, eine schöne poetische Idee dar. Einerseits meint er etwas Konkretes, andererseits verwendet er phantastische Bilder. Hast du dich früher mal mit Lyrik befasst?
Nein. Das war absolut das erste Mal. Schade, später traute ich mich nicht mehr so, da fehlte mir das Selbstvertrauen bei solchen Fragen wie: Was meint der denn damit! Die „e Ziege” entstand in einer Nacht. Einen derartigen Wurf brachte ich dann nicht mehr zustande. Der „Engerling-Blues” – in gewisser Weise vergleichbar – brauchte viel länger. Viele Leute fragten nach dem Sinn des Namens. Eigentlich hatten wir nie eine zufrieden stellende Antwort. Und so haben wir diesen Blues gemacht. Eigentlich sollte er mehr ein Bedauern ausdrücken, dass es keine Maikäfer mehr gibt. Es wurde dann noch was anderes.
Deine Texte sind sehr unterschiedlich, die einen sehr konkret, zum Beispiel die Geschichte um den Profifahrer „Tommy Simpson” zum anderen der sinnbildhafte „Engerling-Blues” oder der phantastische „Tagtraum früh im Park”. Wie erklärst du dir diese Unterschiede?
Aus ganz tollen Gefühlsschwankungen heraus. Wenn ich lange allein bin oder auch bloß allein mit dem Rad fahre oder mit einer Frau zusammen bin, dann kommen mir lyrische Sachen in den Sinn. Auf Tour, also unterwegs zwischen den Konzerten, fallen die Texte konkreter, realer aus. Ich weiß nicht, ob es ein Mangel ist, dass ich mich nicht auf eine Sache konzentriere.
Wolfgang Lange setzte sich einmal kritisch mit dem „Muschellied” der „Tagtraum”-LP auseinander und meinte, der Schlusssatz „Seil dich ab und komm zu mir” sei zu banal als Lösung für die zuvor beschriebenen Probleme einer Frau. Hat er Recht?
Von seinem Standpunkt aus hat er sicherlich Recht. Ich wollte mit diesem letzten Satz das Verhältnis ausgleichen. Nun, es hing auch damit zusammen, dass einfach so ein Zipfel Musik noch da war, und eben noch ein Satz fehlte. Und der passte meiner Meinung nach.
Es wurde oft gesagt, die deutsche Sprache eigne sich nicht für Blues. Ergaben sich für dich derartige Probleme?
So intensiv waren wir dem Blues nie verhaftet, zumindest bei den eigenen Nummern. Ich habe mich nie als Vermittler einer bestimmten Art von Volksmusik empfunden. Für mich war es - es mag ulkig klingen – ganz einfach!
Du bist Bandleiter, Komponist, Texter, Arrangeur. Bestimmst du das Konzept deiner Band?
Es ist schwierig. Ich gehe lieber von meiner Linie ab, als dass ich versuche, andere von meiner Idee zu überzeugen. Und dabei entstehen oft interessante Sachen. Es geht bei uns ziemlich demokratisch zu.
Wir gehen nie mit total fertigen Titeln ins Studio. Aber die Studiozeit ist manchmal ziemlich knapp, so dass im Nachhinein einige Passagen der zweiten LP doch nicht so gut bei mir ankommen. „Auf verlorenem Posten” habe ich gern, das Stück hätte aber noch besser sein können. Mir schweben da einige Sachen vor, die sich zum Beispiel mit dem Namen Steve Reich verbinden, einem Komponisten der modernen Ernsten Musik. Den verehre ich, den könnte ich stundenlang hören. Etwas in seiner Art wollte ich konsequenter probieren, leider fehlte mir der Mut.
Du interessierst dich also für die moderne E-Musik?
Mehr als für Rockmusik.
Was interessiert dich an Steve Reich und der so genannten Minimal-Music?
Eigentlich hat das, so wird es oft abgetan, Didaktisches, mehr übungen, die man so runterspielt. Mich hat der Sound überzeugt. Völlig ohne Elektronik, es klingt aber nach Elektronik. Beim Hören der Platten bin ich bald wahnsinnig geworden. Irgendwie entspricht es meinem Wesen, etwas langsam sozusagen. Eine gewisse Monotonie in der Musik begrüße ich, unmerkliche Veränderungen und doch ganz komplizierte rhythmische Gewebe. In „Tommy Simpson” habe ich es, funktionell aufs Radfahren bezogen, versucht.
Andererseits habe ich durch die Arbeit in der Amiga-Bluesband (eine Formation, die von Amiga für ein LP-Produktion zusammengestellt wurde – d. A.) wieder einen Touch bekommen, härter zu spielen.
Mir fiel bei der Amiga-Bluesband-LP auf, dass zwar Stücke von Robert Johnson dazu gehören, die verwendeten Interpretationen stammen aber meist von Clapton oder anderen.
Klar, auch „Maggie‘s Farm” ist ja nicht nach Dylan, sondern in der Art der englischen Bluesband eingespielt worden. Es wäre sicherlich interessanter gewesen, sich auf die Bearbeitung der Originale zu verlegen. Aber da spielten wohl kommerzielle Erwägungen eine Rolle. Das war ein Zugeständnis. Die Zeit fehlte übrigens auch.
Ich erinnere dich jetzt noch einmal an Steve Reich und frage dich nach der weiteren Entwicklung von Engerling.
Eine traditionelle Bluesband sind wir sowieso nicht mehr. Das Gefühl dafür wird bei mir immer bleiben. Trotzdem werden - auch durch die Erfahrung von „Da hilft kein Jammern” – neue Titel wenig mit dem Bluesschema zu tun haben. Ich kann es mir so vorstellen, wie es die Stones machen. Auf jeder Platte haben sie einen Blues, der Rest klingt anders. Inzwischen gibt es eine Menge anderer Einflüsse, früher sah das anders aus. Da hörten wir nur Blues und Rock’n’Roll.
Was zählt heute zu deinen Einflüssen?
Hauptsächlich Leute, die lange auf der Szene sind, zum Beispiel Van Morrison von Them.
Und die heutige Rockmusik?
Ich muss sagen, die ist für mich undurchschaubar geworden. Jedenfalls diese Fülle, die ganze „Deutsche” Szene. Ich finde vieles unheimlich gut, was die Spritzigkeit und den Sound betrifft, abgesehen von den vielen Klischees. Bands kann ich gar nicht nennen. Für mich sind es immer noch die Doors, die Stones und die anderen Alten von früher. Von uns vielleicht Pankow, da könnte ich richtiger Fan sein. International absolut konkurrenzfähig. Das Umschwenken gestandener DDR-Bands gefällt mir nicht. Denn es ist doch so. Den jungen Leuten, die das Recht hätten, die neue Rockmusik zu machen, bleibt dadurch keine Chance. Das ist das Traurige. Die einzigen, die es schaffen werden, sind die Jungs von Rockhaus. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen leichter. Als Bluesband hat man eben so ein Publikum. Solange unsere Musik noch bluesmäßig bleibt, vom Gefühl her, gehen unsere Hörer mit. Große Sprünge haben wir ja nicht nötig.
Verständigen sich die Bluesmusiker unseres Landes untereinander, kennt man sich gut?
Nein.
Also der Eindruck einer gewissen Distanz trügt nicht?
Früher war das Verhältnis unter uns besser. Kerth war immer der anerkannte Meister. Ehrfurchtsvoll haben wir ihn beobachtet. Wir wollten nicht einfach die kumpelhafte Tour reiten: Tach, Jürgen, wie jehts denn so... Der war zu hoch. Wir spielten mal in Karlshorst, und Kerth kam ohne Schlagzeuger an. Als wir ihn fragten, was nun passiert, wer nun spielt, sagte Kerth, an unseren Schlagzeuger gewandt: Na, du! So einfach ging das! Monokel spielt auch eine andere Richtung. Ich glaube, die bedauern uns. Und einige von uns halten sich bei ihnen im Konzert die Ohren zu. Vom musikalischen Gefühl her war mir Ergo aus Erfurt immer am sympathischsten.
Kann man Blues sein Leben lang spielen?
Ich glaube schon, zumindest wenn man schwarz und darin tief verwurzelt ist. Auf die Dauer ist es für einen Europäer doch sehr simpel. Bei mir geht es noch, ich bin als Pianist und Sänger genügend beschäftigt. Aber so ein Bassist und Schlagzeuger, die nur ihre paar Posen vorzeigen dürfen. Wer da kein richtiger Fan ist, ermüdet sicherlich sehr schnell.
Von großen Improvisationsteilen habt ihr inzwischen ein wenig Abstand genommen, eure Titel unterscheiden sich im Konzert nur unwesentlich von den Platteneinspielungen. Wie aber fügt ihr diese Titel zu einem Programm? Macht ihr euch Gedanken um dramaturgische Zusammenhänge und Abläufe?
Eine Zeitlang, wenn uns ein Programm zum Hals raushing, rief ich einen Titel aus, und den spielten wir dann. Bei wichtigen Konzerten erwies sich manchmal, dass irgendwas nicht lief, und dann änderten wir spontan den Ablauf. Es fällt uns ziemlich schwer, in großen Sälen zu spielen. Da kommt es auf Genauigkeit im Stimmungsauf- und –abbau an. Diesen Mechanismus müssen wir noch durchschauen. Die brennende Luft der Klubhektik inspiriert uns mehr. Was Dramaturgie und Programmgestaltung betrifft, da beeindruckte mich Pankows „Paule Panke” unwahrscheinlich. Dass kann man zwar nicht nachvollziehen, obwohl wir von der Idee her auch gerade an einem Aufhänger für ein neues Programm basteln. Es geht um die Moll-Story von damals. Einige Nummern lassen sich zuordnen. Moll singt diese Geschichten, Moll ist eine Figur, die unser Publikum noch kennt und die wir als Träger verschiedener Erlebnisse nutzen wollen. Natürlich stecke ich etwas drin. �Molls Party� teilt zum Beispiel ein unangenehmes Erlebnis von mir mit, als ich eine Fete machen wollte, keiner kam, ich sehr viel von den bereit gestellten Flaschen trank und dann in Melancholie und Trauer verfiel, weil mich offenbar keiner leiden konnte. Glücklicherweise hing es mit einem verwechselten Datum zusammen.
Wie stellst du dir die nächsten zwanzig Jahre von Engerling oder Bodag vor?
Von Engerling – weiß ich nicht. Und von mir? Ob ich das Live-Auftreten verkraften werde, muss ich sehen. Das fällt mir jetzt schon schwer, vor allem psychisch. Zu viel Leerlauf, Rumhängen in Hotels. Wenn ich eine gute Form fände – es handelt sich um technische Voraussetzungen -, dass ich mein Fahrrad mitnehmen könnte, würde ich es noch vierzig Jahre aushalten. Wenn ich mir also innerhalb der Konzert-Touren einen Ausgleich schaffen könnte....
Du könntest doch ein Klapprad nehmen!
Nee, nee, nee! Nur Rennräder! Ansonsten – es klingt etwas vermessen: Neulich bekam ich einen Anruf wegen einer Filmmusik. Das wäre was. Ich habe auch mal jahrelang in der Camera Stummfilme begleitet. Das war toll!